Schreibkonventionen
Allgemeine Hinweise, Rechtschreibung
Inventarnummer
Format der Inventarnummer in der M-Box
Die Inventarnummer besteht aus bis zu drei Teilen, die durch einen Schrägstrich getrennt sind: Vorspann/Mittelteil/Nachspann
Der Vorspann nimmt die Indizes der unterschiedlichen Nummernkreise der Bestände auf, z.Bsp. AÖMV, BM, CalphaVa, EMK, M, NHM, ÖMV, oNr, Rot etc.
Der Mittelteil ist die fortlaufende Nummer (ohne Tausenderpunkt).
Der Nachspann nimmt die Subnummern bei Paaren oder Objektgruppen auf.
Die Indizes für Fotoobjekte lauten:
dia, dig, neg, pos, str, diaEMK, posEMK, posEMKoNr, strEMK
Der Vorspann kann unausgefüllt bleiben, wenn der Index nicht zu ermitteln ist.
Der Mittelteil ist zwingend auszufüllen.
Der Nachspann ist optional.
Außer den beiden Schrägstrichen, die im Format der Inventarnummer definiert sind, darf kein Sonderzeichen (. , ; : ! ? etc.) und kein Leerzeichen verwendet werden.
AÖMV/8346 dia/4832
BM/89 dig/1917
CalphaVa/137 neg/12401
EMK/4812/ab pos/24890
M/617 str/1204/33A
NHM/84213/ab diaEMK/2388
ÖMV/6000/000 posEMK/8677
ÖMV/6000/001 posEMKoNr/7
ÖMV/6000/002 strEMK/10/18
oNr/1564
Rot/256
178/10
Paare:
Die Bezeichnung Paar wird ab sofort sehr streng im eigentlichen Wortsinn interpretiert. Paare sind zwei Gegenstände/Dinge, die ich nicht einzeln verwenden kann, also z.Bsp. ein Paar Schuhe, ein Paar Socken, ein Paar Manschetten, ein Paar Handschuhe.
Ein Paar belegt in der M-Box eine Karteikarte und zählt als ein Objekt.
Die Inventarnummer bekommt keinen Nachspann. Es gibt auch keine Gesamtaufnahme (Nachspann /000).
Im Feld „Gegenstand“ wird konsequent und einheitlich angeführt, dass es sich um ein Paar handelt.
Im Feld „Teile“ wird die Info, dass es sich um ein Paar handelt und aus welchen Teilen es besteht, eingetragen. Die in der Vergangenheit verwendeten Nachspanne „ab“ bzw. „001 und 002“ werden hier weiter verwendet.Bei der Beschriftung und Zitierung wird a bzw. 001 immer für das von der Trägerin bzw. vom Träger aus gesehen linke Teil, b bzw. 002 immer für das von der Trägerin bzw. vom Träger aus gesehen rechte Teil verwendet.
Gesamtaufnahme und Subnummern:
Bei Objektgruppen wie z.Bsp. einem Service oder Bestecksatz erhalten die einzelnen Teile fortlaufende Subnummern. Diese Subnummern werden mit Führungsnullen geschrieben, damit der Computer richtig zählen kann. Die Anzahl der Führungsnullen hängt von der Gesamtzahl der Subnummern ab. Objektgruppen mit bis zu 999 Subnummern erhalten zwei Führungsnullen, z.B. ÖMV/123456/001 bis ÖMV/1234546/037. Eine Objektgruppe mit mehr als 1000 Subnummern braucht drei Führungsnullen, z.B. ÖMV/123456/0001 bis ÖMV/123456/1234.
Die Gesamtaufnahme enthält im Nachspann nur Nullen, die Anzahl hängt von der Gesamtanzahl der Subnummern ab (siehe oben).
Bsp: ÖMV/20500/000 (Gesamtaufnahme Service mit 250 Einzelteilen = 250 Subnummern)
Die einzelnen Teile werden mit einer fortlaufenden Subnummer bezeichnet.
Bsp: ÖMV/20500/001 (Kanne mit Deckel)
ÖMV/20500/002 (Zuckerdose mit Deckel)
ÖMV/20500/003 (Tasse)
ÖMV/20500/250 (Kerzenleuchter)
Sprachcodes für nicht deutschsprachige Feldinhalte
Die M-Box liefert standardmäßig bei Feldinhalten im Hintergrund als Sprache "deutsch" mit. Wenn ein Feld einen anderssprachigen Inhalt hat, muss das direkt beim jeweiligen Feld hinterlegt werden.
Wenn man sich im Bearbeitungsmodus befindet und den Feldinhalt eingetragen hat, kann man über die rechte Maustaste das Kontextmenü aufrufen. Hier "Sprache auswählen..." anklicken. Ein Zusatzfenster öffnet sich, in das der jeweilige Sprachcode eingetragen werden kann. Mit dem Button "Sprache auswählen" wird bestätigt. Der eingegebene Sprachcode wird im rechten oberen Eck des Feldes in eckiger Klammer angezeigt.
Wenn ein Feld zwei- oder mehrsprachigen Inhalt hat (z.B. Werktitel in Deutsch, Englisch und Polnisch,) müssen entsprechend viele Felder angelegt und der Inhalt in die einzelnen Sprachen gesplittet werden.
Wir arbeiten mit den ISO 639-3 Sprachcodes. D.h. der eingetragene Code muss immer dreistellig sein.
Die ISO Code-Tabelle findet sich hier: https://iso639-3.sil.org/code_tables/639/data/all
Die häufigsten Codes sind:
eng / Englisch
fra / Französisch
nld / Niederländisch (Flämisch)
ita / Italienisch
spa / Spanisch (Kastilisch)
por / Portugiesisch
ces / Tschechisch
slk / Slowakisch
pol / Polnisch
ukr / Ukrainisch
rus / Russisch
hun / Ungarisch
ron / Rumänisch
slv / Slowenisch
hrv / Kroatisch
srp / Serbisch
hbs / Serbo-Kroatisch
bos / Bosnisch
sqi / Albanisch
mkd / Makedonisch
ell / Griechisch (modern)
dan / Dänisch
nor / Norwegisch
swe / Schwedisch
fin / Finnisch
isl / Isländisch
kal / Grönländisch (Kalaallisut)
Einen versehentlich eingetragenen, gespeicherten Sprachcode kann man nicht mehr löschen. Um ihn quasi zu entfernen, muss man ihn durch den neutralen Code "de" für die Standardsprache ersetzen.
Namensansetzung Personen
1. Namen allgemein
1.1 Familienname, Vorname
Wenn der Vorname bekannt ist, wird er ausgeschrieben.
Sind mehrere Vornamen bekannt, werden sie ebenfalls ausgeschrieben.
Wenn der Vorname nur abgekürzt bekannt ist und sich nicht klären lässt, wird er in der Abkürzung angeführt.
Wenn nur das Initial des Vornamens bekannt ist, wird dieses angeführt.
Sind die Initialen mehrerer Vornamen bekannt, werden alle Initialen mit Leerstellen dazwischen angeführt.
Ist einer der Vornamen bekannt, der andere abgekürzt, wird alles angeführt und eine Leerstelle dazwischen eingefügt.
Bsp.:
Adenauer, Konrad
Wentzel-Mayer, Fr.
Schenk, Johannes Chrysostomos
Friedl, Anna Maria
Hitting, M. H.
Menradt, J. Christian
Zetler, Fr. Borgias
Strieder, Peter G.
Wenn der Vorname überhaupt nicht erwähnt oder nur abgekürzt angeführt wird, das Geschlecht aber bekannt ist, wird nach dem Familiennamen in runder Klammer (Frau) bzw. (Herr) angesetzt.
Bsp.:
Anschütz (Frau)
Anschütz, B. (Frau)
Singer (Herr)
Rudlich, Kl. (Herr)
Ist statt des Vornamens eine Verwandschaftsbezeichnung angegeben, wird diese Bezeichnung in Klammer nach dem Familiennamen angefügt. Falls nähere Informationen vorhanden sind, fließen diese in das Feld Bemerkungen ein.
Bsp.:
Malwing (Sohn) = Sohn der Familie Malwing
Gärtner (Tochter) = Tochter der Familie Gärtner
Gärtner (Tochter)
Bemerkungen: Tochter von Anna Gärtner
Kennt man weder Vorname, Geschlecht noch Verwandtschaftsbezeichnung, so ist nur der Familienname anzuführen.
Bsp.:
Durkopp
Leifinger-Richter
Akademische und berufsbezeichnende Titel werden auf der Personenkarteikarte im Feld Name mit Titeln des Suchbegriffs erfasst, und zwar unter Anführung des gesamten Namens.
Bsp.:
Dr. Berta Daller
Mag. M. Wolfgang Eberl
Dr. Lederer-Eschen (Frau)
Wenn der Name einer Person ganz unbekannt ist, diese Person aber mit einem Notnamen belegt ist, wird dieser Notname angesetzt.
Bsp.:
Meister des Hausbuches
Meister der Donauschule
Vulgonamen werden als Synonyme verwaltet.
Bsp.:
Pichlbauer, Hans Synonym: Pfanstiel
1.2 Namen mit altersbestimmenden Zusätzen
Altersbestimmende Zusätze wie „der Ältere“, „der Jüngere“, „Junior“ oder „Senior“ werden dem Namen in abgekürzter Form ohne Komma nachgestellt.
Verschiedene Personen gleichen Namens, häufig bei Künstler- und Handwerkerfamilien, können durch nachgestellte römische Ziffern unterschieden werden.
Bsp.:
Fink, Johannes Baptist d.Ä.
Hofner, Katharina d.J.
Klass, J. sen.
Schultze, Fritzchen jun.
Gasser, Josef I.
Gasser, Josef II.
1.3 Ausländische Namen
Ausländische Namen werden in der Form angesetzt, die im jeweiligen Land üblich ist, sofern sie in der eingedeutschten Schreibweise nicht bekannter sind.
Namen aus Ländern mit nichtlateinischen Alphabeten werden nach der gebräuchlichen Transliteration umgeschrieben.
Bsp.:
Rabelais, Francois
Shakespeare, William
Kolumbus, Christoph
Tursunzoda, M.
Tschaikowski, Peter Iljitsch
Gandhi, Indira
1.4 Namen mit Präpositionen und/oder Artikel
In den germanischen Sprachen wird der einfache unverbundene Artikel vor dem Namen nicht berücksichtigt.
Bsp.:
Vries, Jan de
Kinderen, Timon Henricus der
In den romanischen Sprachen wird der einfache unverbundene Artikel zum Namen gezogen.
Bsp.:
Le Fort, Gertrud von
La Marmora, Alphons
Die einfache unverbundene Präposition vor dem Namen wie vor Artikel und Namen wird nie berücksichtigt.
Bsp.:
Humboldt, Wilhelm von
Hagen, Friedrich Heinrich von der
Lagarde, Paul de
Las Cagigas, Isidro de
Linden, Else van
Call, van
Sind Präpositionen und Artikel verschmolzen oder fest verbunden (am, auf'm, aus'm, im, vom, vorm, zum, zur; ten, ter, thor, vander; du, des; del, della, dei, degli, delle usw.), so werden sie zum Namen gezogen.
Bsp.:
Zur Linde, Otto
Vorm Walde, Rüdiger Dr.
Vander Linden, Albert
Della Corte, Francesco
1.5 Adelstitel
Adelstitel werden an den letzten Vornamen ohne Komma angefügt. Wenn der Vorname nicht bekannt ist, werden sie dem Nachnamen mit Komma nachgereiht.
Nachname, Vorname Adelstitel
Bsp.:
Poellath, von
Essenwein, Esmeralda von
Seide, I.E. von
Moltke, Helmut Graf
Trattner, Anna Maria Edle von
Walcher von Molthein, Alfred Ritter
Goez, Joseph Franz Freiherr von
Jürgens, Carla von Dr.
Moltke, Helmut Graf Dr.
Stephan, von Mag.
Poellath, von Dr.
1.6 Herrschertitel
Herrschertitel beziehen sich auf Kaiser, Könige, Herzöge, Kurfürsten, Fürsten etc.
Bei Herrschernamen werden der Vorname, die Zählung in römischen Ziffern und, getrennt durch ein Komma, der Titel genannt.
Umfangreiche Angaben zum Territorium sowie Lebens- oder Regierungsdaten können in den entsprechenden Feldern der Personenkarteikarte verarbeitet werden.
Vorname Zählung, Titel
Bsp.:
Albrecht V., Herzog von Bayern
Friedrich II., König von Preußen
Franz Ferdinand, Erzherzog
Johann II., Fürst von Liechtenstein
Ist ein Herrscher auch unter einem Beinamen bekannt, kann dieser Beiname als Synonym mit dem eigentlichen Herrschernamen verknüpft werden.
Bsp.:
Friedrich II., König von Preußen Synonym: Friedrich der Große
Ernst I., Herzog von Sachsen-Gotha-Altenburg Synonym: Ernst der Fromme
Ist ein Herrscher auch unter seinem persönlichen Namen mit beigefügtem Familiennamen bekannt, so kann diese Konstellation als Synonym mit dem eigentlichen Herrschernamen verknüpft werden.
Bsp.:
Rudolf I., König des Römisch-Deutschen Reiches Synonym: Rudolf von Habsburg
1.7 Geistliche Würdenträger
Namen geistlicher Würdenträger beziehen sich auf Namen von Päpsten, Kardinälen, Patriarchen, Bischöfen, Äbten usw.
Bei geistlichen Würdenträgern werden der Vorname, die Zählung in römischen Ziffern und, getrennt durch ein Komma, der Titel genannt.
Umfangreiche Angaben zum Territorium sowie Lebens- oder Regierungsdaten können in den entsprechenden Feldern der Personenkarteikarte verarbeitet werden.
Vorname Zählung, Titel
Bsp.:
Gregor I., Papst
Ambrosius, Bischof von Mailand
Beinamen von geistlichen Würdenträgern können als Synonym mit dem eigentlichen Namen verknüpft werden.
Bsp.:
Gregor I., Papst Synonym: Gregor der Große
1.8 Pater
Pater wird wie der Titel eines geistlichen Würdenträgers behandelt und dem Namen, getrennt durch ein Komma, nachgereiht.
Nachname, Vorname, Pater
Bsp.:
Meier, Franz, Pater
Josef, Pater
1.9 Künstlernamen
Künstlernamen werden nach folgenden Standardwerken bzw. der GND angesetzt:
Thieme, U. und Becker, F.: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, 37 Bd., Leipzig 1907-1949 (http://www.saur.de/akl/)
Vollmer, H.: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler des XX. Jahrhunderts, Leipzig 1976
Bsp.:
Candid, Peter
Cranach, Lukas d.Ä.
Kaufmann, Angelika
1.10 Namen von Heiligen
Als Standardwerke für die Schreibweise der Namen von Heiligen gelten:
Keller, Hiltgart L.: Reclams Lexikon der Heiligen und der biblischen Gestalten, Stuttgart 1984
Braunfels, Wolfgang (Hg.): Lexikon der Christlichen Ikonographie, Freiburg im Breisgau 1974, Bd. 5-8
Dem Namen wird stets „Hl.“ bzw. "Sel." vorangestellt. Sowohl am Satzanfang als auch im Fließtext wird "Hl." bzw. "Sel." groß geschrieben (hausinterne Vereinbarung).
Altersbestimmende Zusätze werden abgekürzt.
Bsp.:
Hl. Agnes
Hl. Franz von Sales
Hl. Franz von Assisi
Hl. Katharina von Alexandria
Hl. Katharina von Siena
Hl. Jakobus d.Ä.
Sel. Kaiser Karl I.
Namensansetzung Institutionen
Als Institutionen gelten sämtliche Körperschaften wie Personenvereinigungen, Organisationen, Gesellschaften, Vereine, Orden, Bruderschaften, Betriebe, Verlage und Unternehmen, die eine durch ihren Namen individuell bestimmbare Einheit bilden.
Die Körperschaftsnamen werden unter ihrer vollen offiziellen und rechtskräftigen Bezeichnung angesetzt (siehe auch GND).
Bsp:
Olympia Werke AG
Adalbert Breiter GmbH und Co KG
Carl Aug. Seyfried & Comp.
Schönfelds Witwe & Comp.
Alpines Museum der Schweiz
Benediktiner
Bruderschaft der unbefleckten Empfängnis zu Wilten
Alpine Schuhplattler Gesellschaft D'Iselberger
Durch Veränderungen des rechtskräftigen Namens im Laufe der Zeit treten gelegentlich unterschiedliche Ansetzungen für ein und dieselbe Firma auf. Da diese Bezeichnungen den Zeitraum der Entwicklung der Herstellerfirma widerspiegeln, sind sie für die Datierung oder den Herstellungsort des Objekts von Bedeutung.
In so einem Fall kann für jede Ansetzung ein Eintrag im Suchbegriffskatalog gemacht werden. Diese Ansetzungen können über Synonymverknüpfungen miteinander verbunden werden.
Bei allen zeitlich unterschiedlichen Ansetzungen einer Körperschaft in der M-Box wird dann der entsprechende GND Code des Vorzugsbegriffs vermerkt (bei dem sich in der Regel die Erläuterungen zu Vorgängern oder Nachfolgern der Bezeichnungen befinden). So werden die variierenden Ansetzungen wieder zusammengefasst.
Bsp:
Glastechnisches Laboratorium Schott und Gen. (von 1884-1893)
Jenaer Glaswerke Schott und Gen. (von 1893-1990)
Jenaer Glaswerke (ab 1990)
Ist der rechtskräftige Name einer Körperschaft nicht bekannt, empfiehlt es sich, zur einfacheren Recherche den Familiennamen nach vorne zu setzen.
Ortsangaben
Angabe "unbekannt" oder "nachtragen"
Die Angaben "unbekannt" oder "nachtragen" werden immer klein geschrieben.
Angabe "unbekannt" oder "nachtragen" bei Feldgruppen für Personen, Institutionen oder Orte:
Wird bei diesen Feldgruppen im linken Eingabefeld (z.B. Name (V)) "unbekannt" oder "nachtragen" angegeben, so muss auch im rechten Eingabefeld (z.B. Rolle (V)), auf die sich die Angabe bezieht, eine Rolle angeführt werden. Diese Rollen werden im Dropdown aus der Inhaltsliste ausgewählt.
Angabe "unbekannt" oder "nachtragen" bei Feldgruppen für Datum:
Möchte man bei einer Datierung "unbekannt" oder "nachtragen" anführen, so bleibt das linke Eingabefeld (z.B. Zeitraum (V)) leer und im Eingabefeld für die Annotation rechts wird im Dropdown "unbekannt" oder "nachtragen" ausgewählt. Dies hat den Hintergrund, dass Datumsangaben bestimmten formalen Kriterien entsprechen müssen, um in der Suche entsprechend zu funktionieren.
Datierung
Jahreszahl: immer vierstellig, z.B. 1823, 1960, 2001
Datum mit Monat und Jahr: MM.JJJJ, z.B. 12.2002, 04.1933
Datum mit Tag, Monat und Jahr: TT.MM.JJJJ, z.B. 24.10.1911, 09.05.1800
Jahrzehnt: immer vierstellig mit angehängtem „er“, z.B. 1920er, 1840er
Jahrhundert: immer zweistellig, Jahrhundert wird mit „Jh.“ abgekürzt, z.B. 17. Jh., 19. Jh., 21. Jh.,
8. Jh. v. Chr., 3. Jh. n. Chr.
Hälfte eines Jahrhunderts: z.B. 1. Hälfte 18. Jh., 2. Hälfte 19. Jh.
Viertel eines Jahrhunderts: z.B. 1. Viertel 17. Jh., 3. Viertel 20. Jh.
Drittel eines Jahrhunderts: z.B. 2. Drittel 16. Jh., 3. Drittel 19. Jh.
Von-bis-Angaben: Als Trennzeichen wird der Bindestrich verwendet, ohne Leerzeichen vorher oder nachher, z.B. 1865-1867, 10.1991-02.1992, Ende 19. Jh.-Anfang 20. Jh.
Ungefähre Zeitangaben: können mit Anfang, Beginn, Mitte, Ende, ca., nach, vor, um bezeichnet werden.
Doppelte Ungenauigkeiten wie z.B. ca. Anfang 20. Jh. sind nicht erlaubt.
Nicht erlaubt sind auch wohl, vermutlich, frühes, spätes.
Annotationen zu Datierungen werden im jeweiligen Annotationsfeld im Dropdown aus der Inhaltsliste ausgewählt.
Das "?" bei einer unsicheren Datierung wird durch die Annotation "Angabe ungesichert" ersetzt.
Maße
Bei Objekten erfolgen die Maßangaben in Zentimetern (cm). Es wird max. eine Nachkommastelle angegeben.
Bei digitalen Fotos erfolgen die Maßangaben in Pixel (px).
Seit 5. Juni 2023 wird nach den jeweiligen Werten immer die Maßeinheit (cm oder px) dazugeschrieben. Zwischen Wert und Maßeinheit ist ein Leerzeichen. Die Angaben stehen linksbündig, jeder Wert in einer Zeile.
Es können Zwischenüberschriften verwendet werden, z.B. Druckplatte:
Dimensionen
Die Dimensionen werden mit Großbuchstaben abgekürzt: H für Höhe, B für Breite, T für Tiefe, L für Länge, D für Durchmesser.
H: Maß in der Vertikale. Es wird immer die maximale Höhe angegeben (also z.B. mit Deckel).
B: Maß in der Horizontale
T: Maß ins Räumliche (nach hinten)
D: nur verwenden, wenn das Objekt tatsächlich rund ist. Möchte man die Maße eines Kruges mit Henkel angeben, dann wird B benutzt.
Bei dreidimensionalen Objekten gilt (außer Keramik, Textilien u.a. - haben oft andere Maßangaben mit speziellen Bezeichnungen)
H:
B:
T:
Bei Gemälden und Grafik gilt:
H:
B:
Bei Fotos mit Untersatzkarton gilt:
Foto:
H:
B:
Archivkarton:
H:
B:
Bei digitalen Fotos gilt:
H:
B:
Achtung: Die Angabe der pixel bei den einzelnen Dateien in den Fotoordnern erfolgt B x H (Aufrufen über: Ansicht \ Details auswählen...\ Abmessungen).
Z.B. 2048 x 1536 bedeutet, dass das Foto 2048 Pixel breit und 1536 Pixel hoch ist. Bei der Übernahme der Maße in die M-Box ist die Reihenfolge dieser Angaben umzudrehen.
H: 1536 px
B: 2048 px
Spezielle Angaben wie zB. Taillenweite, Wandstärke werden ausgeschrieben, da nicht vorausgesetzt werden kann, dass jede/r die Abkürzungen versteht.
Spezifikationen zu Dimensionen werden nach den Abkürzungen angeführt:
L Ärmel:
B Rücken:
D Boden:
D Mündung:
D Rand:
D max.:
B Rahmen:
B mit Henkel:
H ohne Deckel:
Beispiele:
Gemälde
H: 36,5 cm
B: 28,4 cm
T: 3,8 cm
Rock:
L: 96 cm
Taillenweite: 74,5 cm
Krug:
H: 34,2 cm
D: 8,2 cm
D Standring: 6,4 cm
Handtasche:
H: 26,3 cm
H ohne Henkel: 26,3 cm
B: 14,5 cm
T: 4 cm
Zeichen für Gliederung der Abschrift im Feld "Inschrift / Aufschrift"
Thesaurusbegriffe
Literaturangaben in den Feldern "Objekt wird zitiert in" und "Weiterführende Informationen"
Monographie, ein Autor:
Dexel, Thomas: Gebrauchsglas. Gläser des Alltags vom Spätmittelalter bis zum beginnenden 20. Jahrhundert. München 1983.
Endres, Werner: Gefäße und Formen. Eine Typologie für Museen und Sammlungen. München 1996 (= Museums-Bausteine 3), S. 120.
Haberlandt, Michael: Österreichische Volkskunst II. Aus den Sammlungen des Museums für österreichische Volkskunde in Wien. Wien 1911, S. 24 und Taf. 71/2.
Schuchardt, Hugo: Hugo Schuchardt an Adolf Mussafia. Graz 1905, S. 10-11 und Abb. 13. [es gibt Text zum Objekt auf den Seiten 10-11 sowie eine extra Abbildung]
Bezdek, Susanne & Kathrin Pallestrang: Rasanter Stillstand. Impressionen unter Covid-19. Wien 2021, Kat.Nr. 8 und S. [7] (Abb.). [unpaginierte Broschüre - es gibt einen Katalogtext mit der Nummer 8 und eine Abbildung ohne Abbildungsnummer auf der unpaginierten Seite 7]
Monographie, ein Autor, Band:
Haberlandt, Michael (Hg.): Werke der Volkskunst, Bd. 1. Wien 1914, S. 45-48 und Taf. XIII, Fig. 1-5.
Monographie, ein Autor, Auflage:
Dexel, Thomas: Gebrauchsglas. Gläser des Alltags vom Spätmittelalter bis zum beginnenden 20. Jahrhundert. 2. Auflage. München 1983.
Monographie, zwei Autoren:
Grieshofer, Franz & Margot Schindler (Red.): Papageno backstage. Perspektiven auf Vögel und Menschen. Wien 2006, S. 93.
Kos, Wolfgang & Ralph Kreis (Hg.): Experiment Metropole. 1873: Wien und die Weltausstellung. Wien 2014, S. 340.
Monographie, drei Autoren:
Grieshofer, Franz, Kathrin Pallestrang & Margot Schindler (Red.): Papageno backstage. Perspektiven auf Vögel und Menschen. Wien 2006, S. 93.
Monographie, zwei Autoren, zwei Orte, Reihe:
Beitl, Klaus & Ivan Sedej (Hg.): Der Mensch und die Biene. Die Apikultur Sloweniens in der traditionellen Wirtschaft und Volkskunst. Ljubljana, Wien 1989 (= Veröffentlichungen des Österreichischen Museums für Volkskunde 24).
Beitrag in Zeitschrift:
Kierdorf-Traut, Georg: Nabelflaschen aus der Kramsacher Hütte. In: Der Schlern. Illustrierte Monatshefte für Heimat- und Volkskunde 39/1965, S. 108-109.
Kollreider, Franz: Ein bisher unbekanntes Fastentuch aus Lienz in Osttirol? In: Osttiroler Heimatblätter 55/H. 5/1987, S. 1-2.
Schindler, Margot: Kostüm einer Dame bei Hof. In: Österreichische Zeitschrift für Volkskunde XLVII/1993, S. 419-446.
Pallestrang, Kathrin: Fotostrecke: Corona-Lockdown. In: Österreichische Zeitschrift für Volkskunde LXXIV/2020, S. 173-186, hier S. 177, Abb. 5. [es gibt eine Abbildung auf S. 177]
o.A.: Mitteilungen aus dem k. k. Museum für österreichische Volkskunde. 3. Vermehrung der Sammlungen. In: Zeitschrift für österreichische Volkskunde XX/1914, S. 75.
Beitrag in Sammelwerk:
Peschel-Wacha, Claudia: "Sauf wonnst konnst". Das Rätsel um die Vexierkrüge. In: Friederike Lichtwark (Red.): Keramik auf Sonderwegen. 37. Internationales Hafnerei-Symposium, Herne, 19. bis 25. September 2004. Mainz 2014, S. 41-52.
Beitrag in Sammelwerk, Reihe:
Grieshofer, Franz: Reflexionen über den "Tempel des Menschensohnes". Eine Kleinarchitektur im Österreichischen Museum für Volkskunde. In: Institut für Europäische Ethnologie der Universität Wien (Hg.): Begegnungen. Festschrift für Konrad Köstlin zur Emeritierung am 30. September 2008. Wien 2008 (= Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Ethnologie der Universität Wien 32), S. 187-203.
o.A.: Das Templum und Athanasius Kirchers Wissenschaftsverständnis. In: Vonderau Museum Fulda (Hg.): Magie des Wissens. Athanasius Kircher (1602-1680). Jesuit und Universalgelehrter. Petersberg 2003, S. 29-30.
Verlinkung Literaturangaben zu Online-Ressourcen
Literaturangaben können zu Online-Ressourcen verlinkt werden, wenn diese über eine persistente URL verfügen.
Zu unseren derzeitigen Online Publikatonen bitte nicht mehr verlinken - diese werden nach dem Umstieg auf die neue Online Plattform ja sukzessive umgebaut.
Die gesamte Verlinkung findet in einer eckigen Klammer statt.
Tastenkombination für öffnende eckige Klammer: alt gr + [
Tastenkombination für schließende eckige Klammer: alt gr + ]
Der Text, der verlinkt werden soll, steht direkt nach der öffnenden eckigen Klammer.
Dann folgt ein Strich-Punkt mit einem Leerzeichen (diese Zeichen trennen den Text, der online verlinkt wird von dem eigentlichen Link).
Dann folgt ein persistenter Link, der von einer eckigen Klammer geschlossen wird.
Bsp.:
[Brief von Antonio Ive an Hugo Schuchardt vom 05.10.1898 (Briefnummer 08-04935); https://gams.uni-graz.at/o:hsa.letter.2896]
wird ausgespielt als:
Brief von Antonio Ive an Hugo Schuchardt vom 05.10.1898 (Briefnummer 08-04935)
Bsp.:
Krpata, Margit: Zypriotische Ethnographica in österreichischen Sammlungen. In: Margit Krpata & Maximilian Wilding (Red.): Das Blatt im Meer - Zypern in österreichischen Sammlungen. Kittsee 1997 (= Kittseer Schriften zur Volkskunde 8), S. 169-252, hier [S. 171; https://www.volkskundemuseum.at/publikationen/publikation?publikation_id=1538569885605­], [252 (Abb. 25); https://www.volkskundemuseum.at/publikationen/publikation?publikation_id=1538569885605þ].
wird ausgespielt als:
Krpata, Margit: Zypriotische Ethnographica in österreichischen Sammlungen. In: Margit Krpata & Maximilian Wilding (Red.): Das Blatt im Meer - Zypern in österreichischen Sammlungen. Kittsee 1997 (= Kittseer Schriften zur Volkskunde 8), S. 169-252, hier S. 171, 252 (Abb. 25).
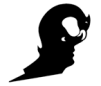
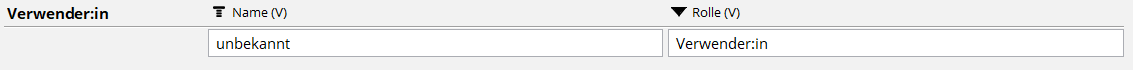
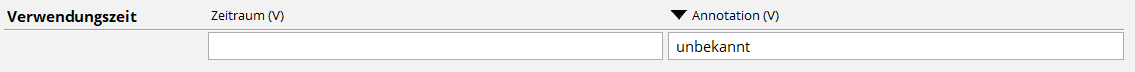
Keine Kommentare vorhanden
Keine Kommentare vorhanden